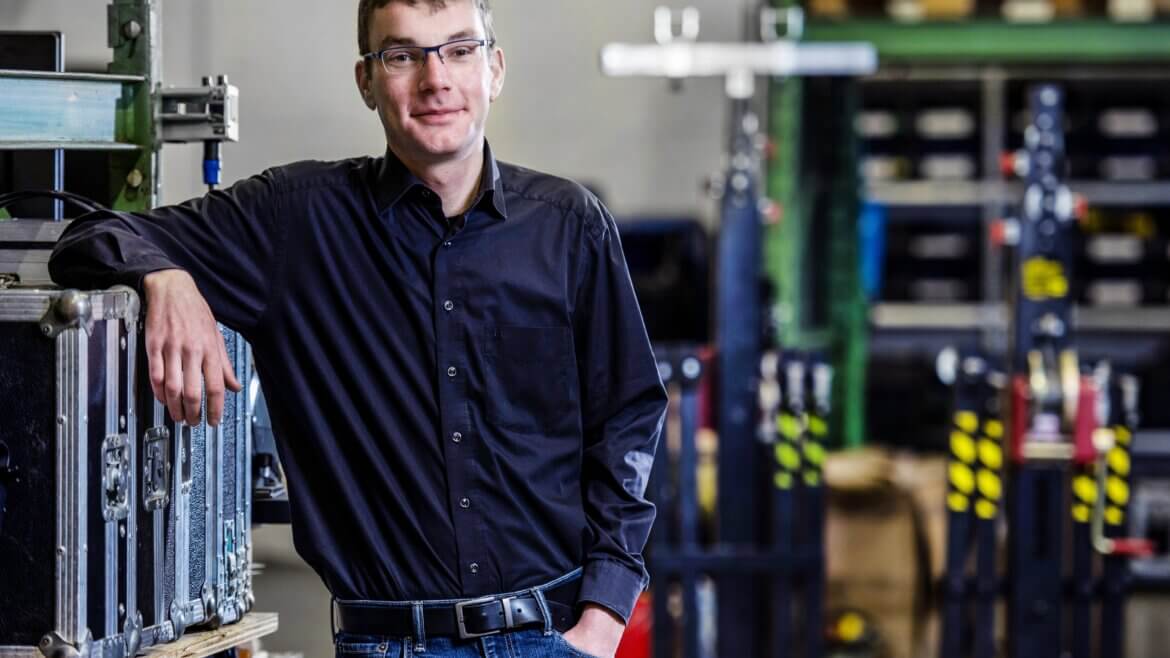Service Learning verbindet Bildung mit Engagement: Schülerinnen und Schüler engagieren sich für die Gemeinschaft und wenden dabei an, was sie im Fachunterricht der Schule gelernt haben. Drei Beispiele zeigen, wie es geht und wie die Projekte in den Schulunterricht eingebunden werden können.
„Die Welt belohnt uns nicht mehr allein für das, was wir wissen – Google weiß ja schon alles –, sondern für das, was wir mit dem, was wir wissen, tun können.“ So beschreibt Andreas Schleicher, Bildungsdirektor bei der OECD und „Vater der PISA-Studie“ die Herausforderung zu entscheiden, was und wie junge Menschen heute lernen müssen. Nur wer gelernt hat, sein Wissen in unterschiedlichen Situationen zur Problemlösung anzuwenden, wer weiß, dass er sein Lebensumfeld mitgestalten kann und wer Verständnis und Empathie für seine Mitmenschen und ihre individuellen Lebensweisen entwickelt, kann gute Lösungen für die komplexen Probleme unserer Zeit finden.
Service Learning ist ein didaktisches Konzept, das Bildungs- und Demokratieförderung verbindet und eine Antwort sein kann auf die Frage, wie eine zukunftsfähige Bildung aussehen kann.
Was kannst du gut, was anderen nützt? Unter diesem Motto entwickeln Schülerinnen und Schüler im Unterricht Engagementprojekte, die eng mit Inhalten aus dem Lehrplan verknüpft sind. Sie engagieren sich in sozialen Einrichtungen, für Klimaschutz und Demokratie, für Integration und vieles mehr. Dabei arbeiten sie mit außerschulischen Partnern wie Vereinen, Stadtteilinitiativen oder gemeinnützigen Organisationen zusammen, können fachliches Wissen aus dem Unterricht in der Praxis anwenden, um an der Lösung realer gesellschaftlicher Probleme mitzuwirken, und stärken Schlüsselkompetenzen wie Kommunikations- und Teamfähigkeit, kritisches Denken und soziales Verantwortungsbewusstsein.
Service-Learning-Projekte dienen zum einen dazu, Lernziele zu erreichen und die fachlichen, sozialen und persönlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Sie lernen hier praxisnah und anwendungsorientiert und können einen konkreten Bezug der schulischen Inhalte zu ihrer eigenen Lebenswelt herstellen.
Zum anderen werden junge Menschen schon früh in ihrem Leben ermutigt, sich für ihr unmittelbares Lebensumfeld zu engagieren, sich mit realen gesellschaftlichen Problemen zu beschäftigen und an ihrer Lösung mitzuwirken und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Die Frage „Was kannst du gut?“ zielt darauf ab, sich ihre individuellen Stärken, Interessen und Neigungen bewusst zu machen und diese in die Projekte einzubringen. So erleben sie ganz direkt, dass sie mit ihren Kompetenzen einen wirkungsvollen Beitrag in der Gesellschaft leisten können.
Mit ihrem Programm sozialgenial fördert die Stiftung Aktive Bürgerschaft Service Learning an Schulen, damit junge Menschen fürs Leben lernen und frühzeitig und herkunftsunabhängig an ehrenamtliches Engagement herangeführt werden. Wie Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter ihren Unterricht mit Service Learning gestalten und was die Schülerinnen und Schüler in ihren Projekten lernen, zeigen Beispiele aus drei sozialgenial-Mitgliedschulen.
Religion: Lebenserfahrung im „Café Kränzchen“
Ein Café – ausgerechnet auf einem Friedhof? Gerade da, denn ein Friedhof sollte kein trauriger Ort sein, so dachten Schülerinnen und Schüler der Hannah-Arendt-Gesamtschule in Soest. Ihre Idee im Religionsunterricht: einen Raum für Begegnungen und Gespräche zu schaffen, ein Café auf dem Osthofenfriedhof.
Die Idee der Schüler passte wunderbar zu den Plänen der Soesterin Martina Brennecke, die ein Friedhofscafé eröffnen wollte. Das „Café Kränzchen“ ist ihr Projekt, und sie kann dabei auf die Mithilfe der Jugendlichen zählen.
Über die Stadt Soest kam der Kontakt zwischen ihr und den Schülern zustande, die Eröffnung des Café Kränzchen im April 2022 wurde von den Schülern tatkräftig unterstützt. Sie machten mit selbst entworfenen Flyern Werbung, besorgten Blumen für die Tischdeko und schenkten Café aus, vor allem aber schafften sie eine Gelegenheit für Gespräche mit den Besucherinnen und Besuchern des Friedhofs. Beide Seiten profitieren, findet Nils, einer der Schüler: „Die älteren Leute erzählen viel aus ihrem Leben, das höre ich mir gerne an, denn von ihren Erfahrungen können wir Jungen profitieren. Im Gegenzug können wir ihnen aber auch mit unserer Erfahrung zum Beispiel im Umgang mit Handys helfen.“
Alle zwei Wochen hat das Café nun mittwochs von 15 bis 17 Uhr geöffnet. „Durch die Kontakte mit den älteren Menschen lernen wir unfassbar viel fürs Leben“, berichtet die Schülerin Lucy. „Wir kommen mit den unterschiedlichsten Menschen ins Gespräch, die wir in der Schule nie treffen würden. Man lernt dabei super viel über den Umgang miteinander: Wertschätzendes Verhalten, ohne Vorbehalte jemandem gegenübertreten und dass Äußerlichkeiten nicht immer alles sind.“
Das Projekt geht weiter, für einen reibungslosen Übergang an den nachfolgenden Jahrgang ist gesorgt: Die Schule hat den Religionsunterricht mittwochs in die Randstunden gelegt. Jetzt liegen der Religionsunterricht und die Café-Öffnungszeiten parallel und die Schüler sind alle zwei Wochen statt in der Schule im Café.
BWL: „Rheine Rockt“ – ein Festival organisieren
„Rheine Rockt“ ist ein eintägiges Musikfestival, umsonst und draußen, mit lokalen Newcomer-Bands und seit der Erstausgabe 2016 aus dem lokalen Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Wer hat’s erfunden? Schülerinnen und Schüler der Kaufmännischen Schulen Rheine.
„Think big!“ war die Ansage von Lehrer Claus Schrichten, als er vor einigen Jahren vor seinen Schülerinnen und Schülern stand und die Marschrichtung für das Schuljahr vorgab. Projekte sollten sie sich überlegen, in denen sie sich sozial engagieren konnten. Einige Schülerinnen hatten daraufhin die Idee, ein Rockfestival zu veranstalten, um Spenden für soziale Zwecke zu generieren. „Rheine Rockt“ war geboren. Es war gleich in der Erstausgabe ein Erfolg und wird seitdem in jedem Jahr im SozialGenial-Kurs am Beruflichen Gymnasium der Kaufmännischen Schulen Rheine organisiert. In dem Wahlpflichtkurs können und sollen die Schülerinnen und Schüler sich für andere engagieren und dabei ihr BWL-Wissen speziell zum Projektmanagement anwenden. Inzwischen ist der Kurs so beliebt, dass unter den Interessenten ausgelost werden muss, wer teilnehmen darf.
Bei der Organisation von „Rheine Rockt“ können die Schülerinnen und Schüler ihre fachlichen Kompetenzen aus den Fächern BWL, Mathematik und Deutsch in der Praxis anwenden. Der Aufgabenkatalog, den sie abarbeiten, steht dem eines professionellen Veranstalters in nichts nach: Sie kalkulieren Budgets und Preise, treffen Absprachen mit der Stadt, werben Sponsorengelder ein, verhandeln Angebote und beauftragen Dienstleister für Bühne, Licht und Ton, Sanitäranlagen, Sicherheit und Ordnung, buchen die Bands, machen Pressearbeit und Werbung, koordinieren die Abläufe am Tag der Veranstaltung.
Zum Schluss wird abgerechnet und dann bleibt – wenn die Kalkulation aufgegangen ist – ein ordentlicher Gewinn aus dem Getränkeverkauf übrig. 2023 konnten die Schülerinnen und Schüler 2500 Euro an roterkeil.net spenden, eine regionale Institution, die sich gegen Kindesmissbrauch und Kinderprostitution einsetzt. Ebenso besteht eine Kooperation mit dem Kinderschutzbund Rheine e.V., der über das Thema „Gewalt gegen Kinder“ vor Ort in der Schule aufklärt.
2023 konnte erstmals eine Betroffene gewonnen werden, die bei dem von den Schülerinnen und Schülern organisierten Event live auf der Bühne über ihre Erlebnisse sprach. Der Auftritt bewirkte, dass sich drei weitere Betroffene aus der Zuschauerschaft meldeten und über „Rheine Rockt“ Erstkontakt zu den benannten Hilfsorganisationen aufbauten. Die Betroffene informierte im Nachgang auch in der Schule über die schwerwiegenden Folgen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder.
Die Planungen für „Rheine Rockt“ 2024 laufen bereits auf Hochtouren.
Wahlpflicht: Belastungen erkennen und bewältigen
Die Corona-Pandemie war eine anstrengende Zeit und hat besonders bei Kindern und Jugendlichen Spuren hinterlassen. Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 und 10 der Heinrich-Heine-Gesamtschule Dreieich (Hessen) wollten in ihrem sozialgenial-Projekt herausfinden, wie ihre Mitschüler diese Zeit erlebt haben, was sie besonders belastet hat und wie sie mit den Belastungen umgegangen sind. Ebenso wichtig war ihnen, mehr Verständnis und Empathie seitens der Lehrkräfte zu gewinnen.
Angesiedelt war das Projekt im Wahlpflichtkurs „Service Learning – Lernen durch Engagement“, in dem sich die Schüler mit Problemen und Herausforderungen in ihrem Umfeld beschäftigen und sich für Verbesserungen einsetzen. Neben der Engagementerfahrung soll der Kurs soziale und methodische Kompetenzen vermitteln.
Die Kursteilnehmer entwickelten einen passgenauen Fragebogen, um zu erfahren, welche Probleme ihren Mitschülerinnen und Mitschülern auf dem Herzen lagen. Um Schulöffentlichkeit herzustellen, konnten sie zudem bei der Aktion „Briefewand“ ihre persönlichen Geschichten anonym einreichen. Die Beiträge wurden thematisch sortiert ausgestellt: So erkannten die Schülerinnen und Schüler, dass sie nicht allein waren mit ihrem Kummer, zudem wurden Lösungsstrategien gezeigt und über Hilfsangebote und Ansprechpartner informiert.
Das Projekt endete mit einem Aktionstag, an dem vier Workshops zu den Themen „Umgang mit Traumata“, „Prüfungsangst“, „Stressmanagement“ und „Gesund und fit durch den Schulalltag“ angeboten wurden.
Die engagierten Schülerinnen und Schüler erfuhren auch durch das Feedback der Schulgemeinde, dass sie etwas bewegen konnten: „Sie übernehmen Verantwortung, sehen, was für eine Wirkung sie haben in der Gesellschaft, das ist eine ganz wichtige Erfahrung“, bilanzierte Kursleiterin und Schulsozialarbeiterin Nicole Bondaug.
Weil die Schülerinnen und Schüler mit ihrem Projekt einen Nerv getroffen hatten, führten sie die Workshops zu Stressmanagement und Prüfungsangst im folgenden Schuljahr gleich noch einmal durch.
Sonja Beckmann, Caroline Deilmann, Stiftung Aktive Bürgerschaft